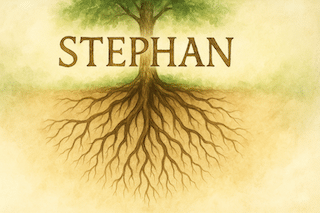Zwischen Feuer und Wasser – Gedanken aus meinem inneren Raum
Ich bin kein Mensch, der seine Herkunft einfach in eine Tradition legen kann.
Nicht in ein Buch, nicht in ein Symbol, nicht in eine Religion.
Ich habe lange geglaubt, dass ich verstehen müsste, woher ich komme – doch irgendwann wurde mir klar, dass meine Fragen nicht nach außen zeigen, sondern nach innen.
Ich suche nicht nach einem Ort.
Ich suche nach einem Ruf.
Ich habe früh gespürt, dass die christlich-jüdischen Antworten, die mir begegnet sind, mich nicht erreichen.
Nicht, weil sie schlecht oder falsch wären,
sondern weil sie zu flach sind für das, was in mir in die Tiefe drängt.
Es ist, als ob meine Fragen älter wären als die Sprache, in der man mir antworten wollte.
Als ich auf die Runen traf, dachte ich einen Moment lang:
Vielleicht ist das meine Wurzel.
Und eigentlich war mein Gedanke noch viel unmittelbarer, viel deutlicher:
Das ist meine Heimat. Das ist meine Sprache. Ich bin wieder zu Hause.
Diese Zeichen – kantig, klar, kraftvoll – fühlten sich vertraut an,
so vertraut, dass ich glaubte, etwas Wiedergefundenes in Händen zu halten,
nicht etwas Neues.
Aber irgendwann begriff ich:
Es sind Tore.
Nicht Anfänge.
Ihre Kraft hat mich berührt, aber sie hat mir auch gezeigt,
dass meine Wurzel weiter zurückliegt als ihre Form.
Dass die Reise hier beginnt, aber nicht endet.
Und dann kam der Buddhismus.
Ganz anders.
Still.
Weise.
Nicht fordernd, sondern haltend.
Nicht kämpfend, sondern klar.
Ich war überrascht, wie sehr mich diese Lehre innerlich berührt.
Es war nicht fremd.
Es war, als hätte jemand einen Ton angeschlagen,
der schon immer in mir war.
Ich konnte ihn nur nie benennen.
Runen und Buddhismus – Feuer und Wasser.
Zwei Welten, die sich eigentlich ausschließen sollten.
Und doch spürte ich, dass beide mich auf dieselbe Weise berühren:
Sie sprechen mit einer Tiefe in mir, die älter ist als Worte.
Mir wurde oft gesagt, ich sei jemand, der Feuer und Wasser mischen kann.
Dass ich Dinge verbinden kann, die andere für unvereinbar halten.
Dass ich Antworten finde, wo niemand die Frage kennt.
Damals wusste ich nicht, was damit gemeint ist.
Jetzt beginne ich es zu verstehen.
Das Feuer in mir kennt Klarheit, Mut, den Blick ins Wesentliche.
Das Wasser in mir kennt Stille, Weite, Vertrauen, das Loslassen.
Beide zusammen ergeben nicht Chaos, sondern Richtung.
Nicht Widerspruch, sondern Zugang.
Ich habe erkannt:
Meine Wurzel liegt nicht in einem einzigen System.
Sie liegt in dem Strom, der unter allen Systemen fließt.
Dort, wo glaubenlose Weisheit beginnt.
Dort, wo Zeichen nicht erklären, sondern erinnern.
Dort, wo Angst nicht Kampf bedeutet, sondern ein Tor.
Ich beginne gerade erst, diesen Ursprung zu spüren.
Nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Körper.
Nicht als Wissen, sondern als Atem.
Ich weiß nicht, wie weit ich gehen kann.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit oder Kraft ich habe.
Aber ich weiß, dass dieser Weg für mich bestimmt ist.
Und dass ich ihn nicht in einem Zug gehen muss.
Der Leser soll verstehen:
Dies ist nicht die Geschichte eines Mannes, der Antworten sucht.
Dies ist die Geschichte eines Menschen, der gelernt hat,
die richtigen Fragen zu hören.
Und dies hier — diese ersten Worte —
sind der Anfang meiner Erzählung.
Der erste Schritt in die Tiefe,
in der meine STEPHAN-Wurzeln liegen.
Der Moment, in dem Heimat zum Ruf wurde
Es war ein eigenartiger Moment, als ich begriff, dass das Gefühl von Heimat nicht dasselbe ist wie der Ursprung.
Heimat ist warm, vertraut, nah.
Ursprung ist tief, alt, manchmal dunkel, manchmal weit.
Und beides berührte mich gleichzeitig, als ich den Runen begegnete.
Zuerst war da dieses unmittelbare Wiedererkennen,
als würde etwas in mir sagen:
Hier bin ich richtig. Hier spricht etwas meine Sprache.
Es war nicht intellektuell.
Es war körperlich, fast wie ein Atemzug, der sich von selbst vertieft.
Aber dann kam die zweite Schicht.
Die größere, leisere, ernstere.
Ich begann zu spüren, dass das, was mich berührt hatte,
nicht der Boden war, auf dem ich stand,
sondern der Wind, der mich rief.
Nicht das Ende der Suche,
sondern ihr Beginn.
Heimat ist das Gefühl, irgendwo anzukommen.
Ursprung ist die Kraft, die dich weiterzieht.
Und plötzlich wusste ich:
Ich kann mich zu Hause fühlen
und trotzdem noch nicht an den Anfang gelangt sein.
Es war kein Verlustgefühl.
Es war eher,
als hätte sich eine zweite Tür geöffnet —
eine tiefere, ältere,
die ich früher nicht sehen konnte,
weil ich auf die erste fixiert war.
Der Buddhismus öffnete dieselbe tiefe Tür,
nur mit einem anderen Klang.
Er zeigte mir eine Ruhe,
die ich bis dahin nicht mit meinem Weg verbunden hatte.
Eine Weisheit,
die nicht erklärt,
sondern durchschaut.
Zwischen den Runen und dem stillen buddhistischen Atem
entstand etwas, das ich nicht benennen konnte:
eine Leere, die nicht bedrohlich war,
sondern wie ein Raum, der auf mich wartete.
Vielleicht ist das der Grund,
warum meine Wurzeln jetzt überhaupt sichtbar werden.
Weil ich beginne zu begreifen,
dass ich nicht zu einer Tradition zurückkehre,
sondern zu einem Zustand.
Ein Zustand,
der älter ist als Symbole,
älter als Kulturen,
älter als jede Form von Glauben.
Ein Zustand,
der unter allem liegt
wie Erde unter Erde.
Und vielleicht beginnt die Reise genau hier:
in dem Moment,
in dem Heimat nicht mehr das Ziel ist,
sondern das erste Zeichen auf dem Weg zum Ursprung.
Der Abstieg beginnt dort, wo die Angst zu sprechen anfängt
Wenn ich ehrlich bin, begann die Reise nicht erst mit Runen oder Buddhismus.
Sie begann in dem Moment, in dem ich begriff,
dass meine Angst kein Gegner ist,
sondern ein Zeuge.
Ich hatte lange versucht, Angst zu überwinden,
zu beruhigen, klein zu machen, zu erklären.
Doch irgendwann wurde mir klar:
Angst ist das Zittern vor einer Wahrheit,
die sich nähert.
Die Kabbala nennt diesen Moment „Gevurah“ –
nicht Strafe,
sondern die Kraft, die prüft,
ob du bereit bist, die nächste Schicht zu betreten.
Nicht, um dich zu verletzen,
sondern um dich zu durchlässig, schlanker zu machen,
damit du nicht mit zu viel Gepäck in die Tiefe steigst.
Angst ist das Tor, das sich erst öffnet,
wenn du stehen bleibst und zuhörst.
Ich sehe heute,
dass meine Angst sich nicht meldete,
weil ich schwach bin,
sondern weil ich an eine Grenze gestoßen bin.
Eine Grenze zwischen dem, was ich kannte,
und dem, was sich in mir erinnerte.
Die Runen zeigten mir Kraft.
Der Buddhismus zeigte mir Stille.
Die Kabbala zeigte mir Tiefe.
Und die Angst zeigte mir:
Hier beginnt der Abstieg.
Es war kein dramatischer Moment,
keine Vision,
keine Erleuchtung.
Es war eher,
als würde sich unter meinen Füßen ein weiteres Stück Erde lösen
und den Blick freigeben auf etwas Dunkles,
etwas Altes,
etwas, das zugleich vertraut und fremd war.
In der Kabbala gibt es den Gedanken,
dass jede Wurzel eine Richtung nach unten und nach oben hat —
wie ein Baum, der im Himmel wurzelt und in der Erde wächst.
Ich habe das nie richtig verstanden,
bis ich meine eigenen Fragen in die Tiefe fallen hörte
und merkte,
dass sie nicht an Stein prallten,
sondern an eine Höhle,
die auf Antwort wartet.
Vielleicht ist das der wahre Beginn:
Nicht der Moment, in dem man etwas findet,
sondern der Moment,
in dem man spürt,
dass etwas einen ruft
und dass die Angst nichts anderes ist
als das Zittern der Schwelle.
Ich habe aufgehört, meine Angst zu beruhigen.
Ich habe angefangen, ihr zuzuhören.
Und seitdem zeigt sie mir einen Weg,
der nicht über Systeme führt,
sondern durch Schichten in mir,
die älter sind als jedes System.
Runen, Buddhismus, Kabbala —
sie sind nicht meine Wurzeln.
Aber sie sind die Lichter am Rand des Pfades,
die mich spüren lassen,
dass dort unten etwas auf mich wartet,
das meinen Namen kennt,
noch bevor ich ihn selbst aussprechen konnte.
Vielleicht ist das der eigentliche Ursprung:
nicht ein Ort,
nicht eine Tradition,
sondern eine Tiefe,
die immer da war,
und die jetzt zum ersten Mal wirklich gehört wird.
Das Bild, das aus der Tiefe kam
Es gab einen Moment in meinem Leben,
lange bevor ich begann, in dieser Tiefe zu suchen,
in dem sich etwas in mir regte,
das ich damals nicht verstehen konnte.
Ich habe ihn nie vergessen,
auch wenn ich ihn viele Jahre lang nicht einordnen konnte.
Ich hatte immer schon eine Angst vor den ägyptischen Göttern.
Nicht die kindliche Angst vor fremden Gestalten,
sondern eine Angst, die sich in den Körper legt,
als wüsste er etwas,
das der Kopf nicht begreifen kann.
Bei einer Isis-Einweihung wäre ich fast erstickt.
Das Ankh, das mir die Rosenkreuzer zeigen wollten,
löste eine Panik aus,
die ich nicht erklären konnte.
Es war keine Abwehr.
Es war eher ein Ertrinken an der Oberfläche,
weil etwas unter der Oberfläche aufsteigen wollte.
Damals verstand ich es nicht.
Ich schob es weg,
versuchte, mich zu beruhigen,
zu normalisieren.
Aber die Bilder kamen immer wieder.
Schwammig,
unfertig,
wie durch Wasser gesehen.
Und dann, eines Tages,
in einer Polarity-Sitzung,
löste sich etwas.
Es war kein Schock und kein Wunder.
Es war eher,
als würde ein Knoten in der Dunkelheit nachgeben
und etwas Licht durchlassen.
Ein Bild stieg auf.
Klarer als sonst.
Ungeordnet, aber dringend.
Ich spürte,
dass ich es verlieren würde,
wenn ich nicht sofort handelte.
Es gab damals kein Google,
keine schnelle Suche,
keine Möglichkeit, das Bild festzuhalten.
Also lief ich los,
als ginge es um etwas,
das ich nicht in Worte fassen konnte.
Ich stürmte in einen Buchladen.
Ich sagte nur:
„Schnell, ich verliere das Bild.
Ein Buch mit den ägyptischen Göttern — bitte, schnell.“
Der Buchhändler erschrak so sehr,
dass er das Buch fallen ließ.
Ich weiß bis heute nicht,
was er in meinem Gesicht gesehen hat.
Aber irgendetwas ließ ihn
nicht nachfragen,
nicht bremsen,
nicht relativieren.
Er hob das Buch auf,
schlug es auf,
suchte nicht,
zögerte nicht,
blätterte nicht einmal lange.
Er hielt inne,
wandte sich leicht zu mir
und fragte:
„Ist er das?“
Und ich wusste sofort,
dass er recht hatte.
Nicht, weil ich den Namen kannte.
Nicht, weil ich vorher von ihm gehört hätte.
Sondern weil mein Atem sich senkte,
mein Körper nachgab,
und ich zum ersten Mal das Gefühl hatte,
ein Bild gefunden zu haben,
das mich schon lange gesucht hatte.
Ich weiß nicht,
ob ich in diesem Moment
erleichterter darüber war,
dass endlich ein Name vor mir lag —
oder darüber,
dass der Buchhändler mich
nicht der vorbeilaufenden Polizeistreife übergeben hat.
Es war ein seltsamer Moment.
Nicht heilig,
nicht dramatisch,
aber eindeutig.
Ein Moment,
in dem etwas aus meiner Tiefe
endlich ein Gesicht bekam.
Ich habe lange gebraucht,
um zu verstehen,
was damals wirklich geschehen ist.
Erst heute,
auf dieser Reise zurück zu meinen Wurzeln,
erkenne ich:
Es war kein Götterruf.
Es war kein Schreckgespenst.
Es war der erste Schatten meiner eigenen Tiefe,
der nach oben drang,
als ich noch nicht bereit war,
ihn zu empfangen.
Der Tee, der mein Körper verweigerte, und der Drache, der mich zeichnete
Es gab eine Zeit,
in der ich verzweifelt nach Antworten griff,
ohne zu wissen,
dass ich dabei Dinge in mir berührte,
für die ich noch keinen Halt hatte.
Damals gab es kein Google,
keine Suchmaschine,
keine schnelle Erklärung.
Alles, was ich hatte,
war ein altägyptisches Orakelbuch.
Man sagte mir:
„Stephan, das hilft dir jetzt.“
Also versuchte ich,
mich daran festzuhalten —
wie jemand,
der krank ist
und einen bitteren Pflanzentee in sich hineinwürgt,
weil andere sagen,
er würde heilen.
Aber mein Körper wehrte sich.
Jede Zelle schrie dagegen an.
Ich versuchte, das Orakel Tropfen für Tropfen zu trinken,
Milliliter für Milliliter,
mit dem Gefühl,
dass ich mich selbst verrate.
Ich weiß nicht mehr,
wann ich es verlegt habe.
Vielleicht hat mein Körper es einfach
aus meinem Leben entfernt,
weil mein Kopf nicht die Kraft hatte,
es wegzustellen.
Und dann kam eine weitere Polarity-Sitzung.
Jemand versuchte,
einen „Drachen“ aus meinem Feld zu entfernen.
Ich wusste damals nicht,
was das bedeuten sollte.
Ich wusste nur:
Etwas in mir sträubte sich.
Was dann geschah,
hat Spuren hinterlassen,
die ich bis heute sehe.
Der Erddrache,
mein Erddrache,
hat mir im inneren Bild
das halbe Gesicht weggerissen.
Nicht als Wesen,
nicht als Mythengestalt,
sondern als eine Kraft,
die ich damals nicht halten konnte.
Ich sehe diese Narbe bis heute,
nicht auf meiner Haut,
aber im Spiegel meines inneren Auges —
quer durch mein Gesicht,
wie ein Schnitt,
der eine Geschichte erzählt,
die ich lange nicht verstand.
Die Menschen erzählen oft begeistert
von ihren Drachen,
von Kraft,
von Weisheit,
von Stärke.
Ich konnte das nie fühlen.
Für mich war der Drache
kein Begleiter,
kein Helfer,
keine Vision.
Er war ein Lehrer,
ja —
aber einer,
der nicht sanft kam,
sondern wie ein Sturm,
der aufreißt,
was nicht trägt.
Vielleicht habe ich ihn gebraucht.
Vielleicht war es notwendig.
Vielleicht war es der einzige Weg,
wie mein Inneres damals
auf sich aufmerksam machen konnte.
Ich weiß nur:
Es war nicht schön,
nicht mystisch,
nicht erhebend.
Es war roh.
Es war schmerzhaft.
Es war ein Teil meines Weges,
den ich erst Jahre später
überhaupt zu verstehen begann.
Und vielleicht gehört genau das
zu meiner Reise zurück zu den Wurzeln:
dass selbst die Bilder,
die mich verletzt haben,
etwas in sich tragen,
das ich heute
mit neuen Augen ansehen kann.
Der Zusammenbruch vor den Runen
Dann kam der Moment, der alles übertroffen hat.
Ein Punkt, an den ich lange nicht zurückgehen wollte,
weil er mehr als Angst war.
Er war ein Zusammenbruch,
ein Blick in etwas,
das ich damals weder verstehen konnte
noch wollte.
Bei einem Umzug hatte ich ein Buch gefunden.
Ein altes, unscheinbares Buch,
das ich einfach zur Seite gelegt hatte,
weil ich damals noch nicht einmal wusste,
dass die Bilder darin zu meinem Weg gehören würden.
Wie schon so oft arbeitete ich ausschließlich mit Büchern,
weil ich sonst keine Orientierung hatte.
Sie waren mein Halt,
mein Werkzeug,
mein einziger Zugang zu etwas,
das ich nicht benennen konnte.
In einer Polarity-Sitzung fragte man mich plötzlich:
„Wo ist dein Runen-Schein?“
Ich wusste nicht einmal,
was Runen sind.
Ich hatte keine Verbindung,
keine Vorstellung,
keine Ahnung,
warum ich so etwas besitzen sollte.
Und dann sah ich sie.
Ich erinnere mich an diesen Augenblick
so klar wie an den Moment,
in dem ein Unfall passiert:
ein Bruch in der Zeit,
ein Einfrieren des Körpers,
ein innerer Absturz.
Ich hatte einen Kreislaufzusammenbruch.
Einfach so.
Ohne Warnung.
Ohne Sinn.
Da waren sie —
die Runen —
und in mir brach etwas auf,
das ich weder zuordnen
noch halten konnte.
Ich dachte:
„Nein. Bitte nicht.
Alles, aber nicht diese Zeichen.“
Denn in mir stieg sofort etwas auf,
das nicht aus meinem Leben stammte:
blutige Bilder,
Zerstörung,
Verzerrung.
Eine Gewalt,
die nicht meine Geschichte war
und trotzdem durch meinen Körper rauschte,
als gehörte sie mir.
Ich habe eine Vermutung, warum —
aber das gehört an einen anderen Ort,
zu einer anderen Zeit.
Ich weiß nicht mehr,
wie viele Jahre vergingen,
bis ich dieses Buch wiederfand.
Vielleicht war es mein Schutz.
Vielleicht war es Verdrängung.
Vielleicht brauchte ich einfach Zeit.
Heute denke ich:
Es musste so sein.
In diesen Jahren lernte ich viele Heil-Systeme kennen,
und ich schien ein Händchen dafür zu haben.
Egal ob Energiearbeit,
spirituelle Methoden,
alternative Wege —
sie öffneten sich mir schnell,
fast selbstverständlich. zu glatt.
Aber etwas störte mich immer wieder.
Ein kleines Unbehagen,
leise, aber hartnäckig.
Diese „intelligenten Energien“,
diese fremden Namen,
diese Lehrer,
die offenbar davon ausgingen,
dass wir verstehen würden,
was sie nicht verstanden.
Und etwas in mir dachte jedes Mal:
„Ihr gebt Informationen weiter,
aber nicht die Wurzel.
Nicht die Quelle.
Nicht das, was wirklich trägt.
Ihr kennt die Quelle überhaupt nicht.“
Ich nahm die Methoden an,
ich lernte schnell,
ich war dankbar —
und zugleich spürte ich,
dass das alles nicht meine Heimat war.
Es waren Werkzeuge.
Aber nicht meine Sprache.
Die Runen,
so sehr sie mich erschreckt hatten,
waren etwas anderes.
Sie waren kein System,
keine Übertragung,
keine geliehene Weisheit.
Sie waren ein Tor,
vor dem ich damals zusammengebrochen bin,
weil ich nicht wusste,
was sie mir spiegelten.
Heute beginne ich zu ahnen,
dass es nicht die Runen waren,
vor denen ich Angst hatte.
Sondern das,
was sie in mir berührt haben —
etwas Tiefes,
Altes,
Eigenes.
Etwas,
das geduldig gewartet hat,
bis ich die Kraft hatte,
nicht mehr davon wegzulaufen.
Warum die Runen damals dunkel wirkten und heute zu meinen Wurzeln sprechen
Wenn ich heute auf diesen Zusammenbruch zurückblicke,
dann sehe ich etwas, das ich damals nicht hätte erkennen können:
Ich hatte nicht Angst vor den Runen selbst.
Ich hatte Angst vor dem, was durch sie in mir berührt wurde.
Zu jener Zeit waren die Runen für mich ein Abgrund,
ein Durcheinander aus fremden Zeichen und fremden Bildern,
überlagert von der Gewalt einer Geschichte,
die nicht meine eigene war
und doch wie ein Schatten auf mir lag.
Ich sah in ihnen nur die Spuren von Menschen,
die sie missbraucht hatten,
und die blutigen Bilder,
die sich wie Reflexe in meinem Inneren ablösten.
Ich wusste nicht, dass diese Bilder
nicht aus mir stammten,
sondern aus einer kollektiven Wunde,
die sich über Symbole legt wie ein dichter Nebel.
Damals war ich nicht bereit,
hinter diesen Nebel zu schauen.
Ich war zu dünnhäutig, zu offen, zu ungeschützt.
Und jedes fremde Energiesystem,
so faszinierend es auch war,
brachte Namen und Kräfte mit sich,
die ich zwar verstehen wollte,
die aber nie wirklich zu mir sprachen.
Ich hatte das Gefühl,
dass ich in jeder dieser Lehren nur das Echo hörte
und nie die Stimme selbst.
Die Lehrer schienen überzeugt,
dass sich ihrem Gegenüber die Bedeutung schon erschließen würde,
doch ich spürte oft nur:
„Das ist nicht meine Sprache.
Das ist nicht mein Weg.“
Die Runen aber waren etwas anderes.
Ich hatte sie abgelehnt,
noch bevor ich wusste, was sie sind.
Ich hatte Angst vor ihnen,
bevor sie mich überhaupt berühren konnten.
Und gleichzeitig war da dieses leise, verstörende Gefühl,
dass sie eine Tür berühren,
die tiefer liegt als alles,
was ich bis dahin gelernt hatte.
Dass ich damals zusammengebrochen bin,
war kein Zeichen von Schwäche.
Es war die Reaktion eines Menschen,
der zum ersten Mal mit einem Symbolsystem konfrontiert wurde,
das nicht von außen kam,
sondern von innen —
und das sich zugleich
mit einem kollektiven Schatten überlagert hatte,
den mein Körper nicht zu trennen wusste.
Heute, viele Jahre später,
sehe ich die Runen nicht mehr als Bedrohung,
sondern als Hinweis.
Nicht als Erbe einer dunklen Zeit,
sondern als Spur,
die tiefer führt als Kultur
und tiefer als Geschichte.
Sie sprechen nicht zu meinem Kopf.
Sie sprechen zu etwas in mir,
das älter ist als jede Methode,
älter als jede Lehre,
älter vielleicht sogar als das,
was ich bisher „Ich“ genannt habe.
Und vielleicht ist genau das der Grund,
warum sie damals so überwältigend auf mich wirkten:
Sie waren kein System, das ich erlernen sollte,
sondern ein Spiegel für etwas,
das bereits in mir angelegt war,
aber noch keinen Namen hatte.
Heute beginne ich zu begreifen,
dass meine Reaktion damals
nicht das Ende,
sondern der erste Schritt war:
ein unfertiges, schmerzhaftes, rohes Beginnen,
dessen Bedeutung sich erst jetzt öffnet.
Den Weg dahin konnte ich damals nicht gehen.
Aber heute,
wo die anderen Systeme leiser geworden sind
und mein eigener innerer Raum klarer,
beginnen die Runen
anders zu klingen.
Nicht als Fremdsprache,
sondern als etwas,
das ich vielleicht schon lange kenne
und jetzt zum ersten Mal wieder höre.
Der Moment, der wie ein Blitz in mein Leben fuhr
Als ich endlich den Mut fand, dieses Buch wieder in die Hand zu nehmen,
fühlte es sich an,
als würde ich eine alte Tür öffnen,
die ich Jahre zuvor hastig zugeschlagen hatte.
Ich wusste nicht, ob ich bereit war,
aber etwas in mir drängte darauf,
dass ich die Übung wenigstens versuche.
Nur ein Versuch,
nichts weiter.
In dem Buch gab es eine Passage,
die ich schon beim ersten Durchblättern bemerkt hatte.
Eine Übung, die großspurig klang
und doch merkwürdig schlicht war:
„Die Verbindung zum Baum der Existenz.“
Es war so unscheinbar beschrieben,
fast harmlos,
als sei es ein kleines Ritual,
ein Kinderreim,
ein spielerisches Annähern.
Und gleichzeitig war da dieser leise Ton in mir:
eine Mischung aus Achtung und Ahnung,
dass das kein Spiel war.
Man sollte ein Sprüchlein sagen.
Man sollte die Arme heben.
Ich weiß nicht mehr, ob man erst das eine oder das andere tat —
aber der Ablauf war einfach,
fast zu einfach.
Luther fiel mir ein,
dieser Mann aus dem Geschichtsunterricht,
den man uns nicht als Rebell zeigte,
sondern als jemanden,
der die Dinge schlicht ernst nahm.
Es ging ihm nicht um Macht,
nicht um Ruhm,
nicht um Nachruhm.
Es ging ihm um die Wahrheit,
und darum, ihr nicht auszuweichen.
Ich dachte an Sinuhe,
den Ägypter,
wie ich ihn damals in der Geschichte gelesen hatte —
wie er diese Prüfung ablegen wollte
und wie er, in der Verzweiflung einer ganzen Nacht,
mit sich kämpfte. er weigerte sich wie die anderen
jedes Rascheln, jeden wehenden Stoff
als göttliches Zeichen deuten zu lassen.
Nicht aus Naivität,
sondern weil er eine Grenze erreicht hatte
zwischen Suche und dem unleugbaren Beweis.
Vielleicht war ich in einem ähnlichen Moment.
Zwischen Hunger nach Antworten
und doch der Angst vor dem,
was passieren könnte.
Ich wollte diese Übung nicht machen,
wo mich jemand sehen konnte.
Also fuhr ich in einen Wald,
der mir völlig unbekannt war.
Ein Ort ohne Geschichte,
ohne Erinnerung,
ohne Zeugen.
Ich dachte, dort würde ich sicher sein.
Dort würde ich Zeit haben.
Dort würde niemand eingreifen.
Und kaum hatte ich angesetzt,
sagte ein ganzer Schwarm lärmender Schüler hinter mir:
„Was macht der denn da?“
Ich hatte mich so gut versteckt —
und doch hatte mich das Leben gefunden.
Ich wusste ich war richtig an diesem Ort.
Also, trotz meiner Höhenangst,
muss ich einen kleinen Pfad hinaufgestiegen sein.
Vielleicht war es nur ein Hügel,
vielleicht eine leichte Erhebung,
aber für mich war es ein Schritt
über eine unsichtbare Schwelle.
Vor mir 3 Tannen.
Ich hob die Arme.
Ich sprach mein Sprüchlein.
Ich tat genau das,
was im Buch stand.
Was dann geschah,
weiß ich nicht mehr.
Es ist eine Lücke.
Ein weißer Raum.
Ein Ausfall.
Ein Moment, der sich nicht erinnern lässt,
aber an dessen Rand eine Kraft steht,
so klar und so durchdringend,
dass mein Leben sich nicht mehr davor verstecken konnte.
Ich weiß nur,
dass ich später davon erzählt habe,
mich habe der Blitz getroffen.
Ich meinte das nicht symbolisch.
Es war die einzige Sprache,
die mir zur Verfügung stand,
um etwas zu benennen,
das nicht in Worte passte.
Von diesem Moment an
war nichts mehr so wie vorher.
Etwas hatte sich in mir geöffnet,
oder gelöst,
oder entzündet —
ich weiß bis heute nicht,
welches Wort stimmt.
Ich weiß nur:
Die Linie meines Lebens
verlief bis zu diesem Tag
in eine bestimmte Richtung —
und nach diesem Tag
ging sie in eine andere.
Es war kein Erleuchtungserlebnis.
Es war keine Vision.
Es war auch kein göttlicher Fingerzeig.
Es war etwas viel Ruhigeres,
aber zugleich Unausweichliches:
Ein Riss im Innersten,
durch den Licht fiel.
Ich verstand nichts davon.
Ich wusste nur,
dass mein Leben sich geteilt hatte
in ein „Vorher“
und ein „Nachher“.
Und dass ich,
ob ich wollte oder nicht,
auf einen Weg gesetzt worden war,
der heute erst
seinen wirklichen Anfang zeigt.
Wie der Blitz kein Wunder war, sondern der Beginn meiner Linie
Als ich später versuchte, diesen Moment einzuordnen,
tat ich lange so, als wäre er etwas Außergewöhnliches gewesen,
etwas Mystisches, vielleicht sogar Überhöhtes.
Denn das war die einzige Kategorie,
in die ich ihn damals legen konnte.
Aber irgendwann wurde mir klar,
dass dieser „Blitz“ kein Geschenk war
und auch keine Strafe.
Er war kein Zeichen von außen
und kein Eingriff eines Wesens,
das mich besuchen wollte.
Er war schlicht der Moment,
in dem sich eine innere Wand gelöst hat,
die ich mein Leben lang
für selbstverständlich gehalten hatte.
Der Blitz war nur ein Wort,
ein verzweifelter Versuch,
eine Erfahrung zu erklären,
die zu groß war für die Sprache,
die ich damals besaß.
Was wirklich geschah,
war viel einfacher
und viel tiefer:
Mein Inneres hat aufgehört, sich zu verstecken.
Nicht, weil ich bereit war.
Nicht, weil ich mutig war.
Sondern weil etwas in mir
nicht mehr warten konnte.
Ich begann zu begreifen,
dass das, was ich mein Leben lang
für Zufälle gehalten hatte,
für Missgeschicke,
für Panikreaktionen,
für innere Überempfindlichkeit —
in Wahrheit
eine stille, über Jahre angestaute Bewegung war.
Eine Bewegung,
die darauf gewartet hatte,
dass ich einen einzigen Moment
lang ernst nehme,
was in mir spricht.
Nicht die Methoden.
Nicht die Lehrer.
Nicht die Systeme.
Nicht die fremden Namen.
Nicht die hochtrabenden Übertragungen.
Sondern diesen Funken,
der schon lange in mir lag
und den ich immer wieder
übersehen oder verwechselt hatte.
Der Blitz war kein Befehl
und kein Ruf von außen.
Er war ein Riss,
durch den ich für einen Moment
mein eigenes Inneres gesehen habe.
Und dieser Anblick
hat alles verändert.
Warum ich seitdem nicht mehr zurück konnte
Nach diesem Erlebnis
wurde jeder Versuch,
zurück in ein „normales“ Leben zu gehen,
zu einer Art innerem Stolpern.
Nicht dramatisch,
nicht destruktiv,
aber unüberhörbar.
Es war,
als hätte jemand
den Kompass in mir neu ausgerichtet.
Die alten Wege waren noch da —
Freunde, Arbeit, Gewohnheiten, Rollen —
aber sie führten nicht mehr irgendwohin.
Es ging nicht darum,
dass mein Leben schlecht war.
Es ging darum,
dass es nicht mehr passte.
Wie Kleidung,
die früher perfekt war
und plötzlich drückt,
ohne dass man sagen kann, warum.
Nach dem „Blitz“
konnte ich Dinge nicht mehr glauben,
die ich früher geglaubt hatte.
Ich konnte Methoden nicht mehr ernst nehmen,
deren Sprache nicht zu mir sprach.
Ich konnte Autoritäten nicht mehr schlucken,
deren Tiefe sich für mich
wie Phrasen anfühlte.
Ich begann,
leise aber unaufhaltsam,
den Weg zu verlassen,
auf den mich andere gesetzt hatten.
Nicht weil ich wollte.
Sondern weil ich musste.
Immer wieder dachte ich
an diesen kleinen Hügel,
an den Spruch,
an die gehobenen Arme
und an die Lücke,
diesen weißen Moment,
in dem etwas in mir
zum ersten Mal frei atmete.
Das war der Beginn meiner Linie.
Nicht einer spirituellen Schule.
Nicht einer Tradition.
Nicht eines Glaubens.
Sondern der Beginn
von meinen Wurzeln.
Von etwas,
das keine Methode braucht,
keine fremden Energien,
keine Namen,
keine Lehrer,
keine Rituale.
Etwas,
das immer da war,
aber erst in diesem Moment
zugänglich wurde.
Etwas,
das nun keinen Rückzug mehr zuließ.
Warum kein System mich halten konnte
Nach dem Blitzmoment begann eine lange, stille Phase,
in der ich versuchte, meine Erfahrungen in ein System zu legen —
nicht aus Naivität,
sondern aus dem Bedürfnis nach Halt.
Ich hatte das Gefühl,
dass da etwas in mir erwacht war,
und ich hoffte,
dass irgendeine spirituelle Lehre
mir erklären könnte,
was da eigentlich geschehen war.
Ich wollte Ordnung.
Ich wollte Struktur.
Ich wollte jemanden, der sagt:
„Ah, das kenne ich. Das ist das und das.
Da gibt es ein Ritual, eine Stufe, eine Regel dafür.“
Aber jedes Mal,
wenn ich mich einem System näherte,
selbst den ernsthaftesten,
selbst den tiefsten,
selbst den jahrtausendealten,
spürte ich eine leise Enttäuschung.
Nicht, weil diese Systeme falsch wären.
Nicht, weil sie oberflächlich wären.
Viele waren wirkungsvoll,
klug,
weise,
jahrhundertelang erprobt.
Aber sie trugen eine Art Vokabular,
eine Fremdsprache,
die etwas in mir verfehlte.
Als würde ich eine komplizierte Grammatik lernen,
die ich zwar verstehen konnte,
die aber nicht die Sprache war,
in der meine innerste Stimme denkt.
Ich nahm an Kursen teil,
ich hörte Lehrer sprechen,
ich las Bücher,
ich lernte Rituale,
ich arbeitete mit Energien,
ich probierte Methoden aus.
Viele davon funktionierten —
manchmal erstaunlich gut.
Aber etwas in mir blieb immer
einen halben Schritt daneben stehen,
als würde es sagen:
„Das ist schön,
aber das ist nicht meins.“
Ich sah Menschen um mich herum,
die in diesen Systemen Heimat fanden.
Es schien ihnen Halt zu geben,
Struktur,
Klarheit.
Es war, als würden sie in eine Sprache eintauchen,
die ihnen längst vertraut war.
Bei mir war es anders.
Ich konnte alles lernen,
alles verstehen,
alles anwenden —
und doch hatte ich das Gefühl,
ich sei Gast in Häusern,
die mir nie gehören würden.
Immer wieder stieß ich auf dieselbe Grenze:
Diese Lehren waren groß,
aber sie waren nicht meine Wurzel.
Sie reichten nicht dorthin,
wo ich hinmusste.
Es war, als hätte der Blitz
mir eine Richtung gezeigt,
die tiefer lag
als alle Wege,
die ich kannte.
Eine Richtung,
die mich zwang,
in einen Raum zu gehen,
der nicht von außen strukturiert war,
sondern von innen.
Es dauerte lange,
bis ich begriff,
was das wirklich bedeutete.
Ich musste aufhören, Systeme zu suchen — um endlich meine Spur zu finden
Der schwierigste Moment war nicht die Angst,
nicht der Zusammenbruch,
nicht die Panik vor den Runen
oder die frühe Begegnung mit ägyptischen Archetypen.
Der schwierigste Moment war der,
in dem ich zugeben musste:
Kein System der Welt
kann mir zeigen, wo meine Wurzeln liegen.
Nicht, weil diese Systeme schlecht wären.
Sondern weil meine Wurzel
nicht in einer Lehre liegt,
sondern unter allen Lehren.
Nicht in einem Weg,
sondern in dem Grund,
aus dem alle Wege überhaupt erst möglich werden.
Bis dahin hatte ich geglaubt,
dass spirituelle Systeme dazu da sind,
uns etwas beizubringen.
Aber ich begriff,
dass sie in Wahrheit
Brücken sind.
Eigene Welten.
Eigene Sprachen.
Ich aber suchte nicht nach einer Sprache.
Ich suchte nach dem Klang,
aus dem alle Sprachen kommen.
Nach dem Ursprung
und nicht nach einem Pfad.
Nach der Wurzel
und nicht nach einem Baum.
Nach dem,
was immer da war,
auch bevor jemand Symbole formte,
Rituale erschuf,
Lehren weitergab.
Ich begann zu begreifen:
Der Blitz hatte mich nicht erleuchtet —
er hatte mich entwurzelt,
damit ich überhaupt erst sehen konnte,
wo meine Wurzeln wirklich liegen.
Und von dort an
konnte ich nicht mehr zurück.
Nicht aus Sturheit,
nicht aus Rebellion,
nicht aus Überzeugung.
Sondern weil etwas in mir
zum ersten Mal sagte:
„Jetzt fängt es an.“
Der Strom unter allen Systemen
Als ich endlich begriff,
dass kein spirituelles System mich würde halten können,
öffnete sich etwas in mir,
das ich lange Zeit übersehen hatte:
ein tiefer, leiser Strom,
der unter all dem lag,
was ich bisher gelernt oder versucht hatte.
Es war kein Konzept.
Keine Lehre.
Keine Energieform.
Keine Inspiration.
Keine Vision.
Nichts, das ich irgendwo hätte nachlesen können.
Es war eher eine Bewegung,
eine Art Grundschwingung,
so alt und so schlicht,
dass ich sie kaum bemerkte —
weil sie nicht spektakulär war.
Nicht laut.
Nicht glänzend.
Nicht fremd.
Nicht besonders.
Sie war… selbstverständlich.
Als wäre sie schon immer da gewesen,
nur überlagert
von all den Stimmen,
die mir sagten,
wie „spirituelle Entwicklung“ auszusehen hätte.
Dieser Strom hatte keinen Namen.
Er wollte auch keinen.
Er verlangte nicht nach Glauben.
Er verlangte nicht nach Symbolen.
Er verlangte nicht nach Beweisen.
Er verlangte nur eins:
Hinhören.
Nicht mit den Ohren,
sondern mit etwas,
das tiefer liegt —
mit dem, was ich immer für meine Intuition gehalten hatte,
das aber eigentlich älter war als das.
Ich begann zu bemerken,
wie vieles von dem, was ich gelernt hatte,
in diesem Strom keine Bedeutung hatte.
Nicht falsch war,
aber ortlos.
Wie hübsche Muscheln,
die man vom Strand mitnimmt,
die aber nicht zum Meer selbst gehören.
Der Strom, den ich spürte,
war nicht „spirituell“ im üblichen Sinn.
Er war elementar.
Nackt.
Ungeformt.
Vor-jeglicher-Form.
Er war das,
was bleibt,
wenn alle Namen verschwinden.
Ich konnte ihn nicht beschreiben,
aber ich konnte ihn erkennen,
wenn ich tief genug wurde.
Er zeigte sich nicht in Bildern,
nicht in Energien,
nicht in Emotionen,
sondern in einer Art
innerem Wissen ohne Worte.
Wie eine Erinnerung,
die nicht an etwas Konkretes gebunden ist,
sondern an ein Grundgefühl:
„Das bin ich.“
Oder vielleicht:
„Das war ich schon immer.“
Ich verstand langsam:
Dieser Strom war nicht die Summe meiner Erfahrungen,
nicht das Echo früherer Begegnungen,
nicht das Resultat von Methoden oder Lehrern.
Es war der unterste Boden meines inneren Raumes.
Nicht das, was ich gelernt hatte,
sondern das,
was mich überhaupt erst
für Lernen empfänglich gemacht hatte.
Nicht der Weg,
sondern der Grund,
aus dem Wege wachsen.
Nicht der Glaube,
sondern die Quelle,
aus der Glauben möglich wird.
Und als ich begann,
mich diesem Strom zuzuwenden,
spürte ich etwas,
das ich nur schwer beschreiben kann:
Nicht Erleichterung.
Nicht Trost.
Nicht Euphorie.
Sondern Heimkehr,
ohne Ziel,
ohne Ort,
ohne Geschichte.
Eine Heimkehr
in das,
was ich war,
bevor ich mir selbst
Namen, Rollen, Methoden
und spirituelle Wünsche gegeben hatte.
Ich ahnte: Meine Wurzel liegt nicht in einem Symbol – sondern im Zustand vor allen Symbolen
Das war der Moment,
in dem ich zum ersten Mal verstand,
warum die Runen mich so überflutet hatten.
Nicht, weil sie „mächtig“ wären
oder gefährlich
oder fremd.
Sondern weil sie
Spuren sind.
Abdrücke.
Ableger eines viel älteren Bewusstseinszustands,
den ich damals nicht halten konnte.
Sie waren ein Echo des Stroms,
aber nicht der Strom selbst.
Dasselbe galt für alle Lehren,
alle Systeme,
alle Methoden,
und auch für die ägyptischen Bilder,
die mich so erschüttert hatten.
Sie alle waren Teil der Oberfläche.
Wichtig.
Kostbar.
Bedeutend.
Aber sie waren nicht meine Wurzel.
Meine Wurzel lag tiefer —
dort, wo keine Tradition mehr spricht,
wo keine Namen mehr wirken,
wo kein Glaube mehr gebraucht wird.
In dem Zustand,
bevor ein Symbol geformt wird.
In der Stille,
aus der überhaupt erst
ein Symbol entstehen kann.
Ich begann zu spüren,
dass ich nicht auf einen Pfad zurückkehre,
sondern auf die Quelle,
aus der alle Pfade kommen.
Und zum ersten Mal
fühlte ich:
Jetzt beginnt meine Reise wirklich.
Der Ruf der Wurzel
Je länger ich diesen Strom in mir spürte,
desto klarer wurde mir,
dass er nicht nur ein Zustand war,
nicht nur eine innere Ruhe
oder eine Art stilles Wissen.
Er war ein Ruf.
Kein Befehl,
keine Stimme,
keine Vision —
sondern ein Zug nach unten.
Eine Bewegung,
die mich nicht irgendwohin führen wollte,
sondern in etwas hinein.
Ich bemerkte,
dass dieser Ruf keine Bilder brauchte.
Keine Rituale.
Keine Lehrer.
Keine Namen.
Er war frei von all dem.
Nackt.
Ehrlich.
Unverpackt.
Und gerade das machte ihn so neu.
Denn alles, was ich bis dahin als „spirituell“ kannte,
kam über Symbole,
über Methoden,
über Geschichten,
über Energien,
über Traditionen.
Es waren Brücken nach außen.
Aber dieser Ruf kam von innen,
und er führte nach innen.
Er verlangte nicht,
dass ich etwas tue,
sondern dass ich etwas lasse:
nämlich die Suche nach Antworten,
die nicht aus mir selbst stammen.
Ich spürte,
wie diese Wurzel sich nicht über Begriffe vermitteln ließ.
Sie sprach nicht in Bildern.
Sie sprach nicht in Archetypen.
Sie sprach auch nicht in der Sprache der Angst,
wie es die frühen Schockmomente taten.
Sie sprach in einem Gefühl,
das ich damals kaum zuordnen konnte:
eine leise, stetige Gegenwart,
die nicht verschwand,
egal wie sehr ich versuchte,
mich wieder an äußeren Wegen festzuhalten.
Es war ein Druck,
aber ein freundlicher.
Ein Pochen,
aber kein Drängen.
Eine Einladung,
aber ohne Erwartung.
Der Ruf sagte nicht
„Komm“.
Er sagte
„Ich bin hier“.
Und plötzlich wurde mir klar:
Ich hatte mein ganzes Leben lang
nicht die falschen Fragen gestellt.
Ich hatte sie nur
im falschen Stockwerk gestellt.
Ich hatte nach Symbolen gesucht.
Nach Schlüsseln.
Nach Türen.
Nach Wegen.
Nach Lehrern.
Nach Erklärungen.
Aber meine Wurzel lag in der Schicht darunter,
dort, wo Fragen
nicht mehr als Sätze formuliert werden,
sondern als Bewegungen,
als Resonanz,
als Stille,
die man nur spürt,
wenn man aufhört,
sie erklären zu wollen.
Der Ruf der Wurzel
war nicht die Aufforderung,
eine Tradition zu finden.
Und er war auch keine Erinnerung
an eine alte Zugehörigkeit.
Er war die Erkenntnis,
dass ich aufhören musste,
mich an die Spuren anderer zu klammern,
um endlich die Spur zu hören,
die in mir selbst verläuft.
Keine Lehre,
kein System,
kein Name
konnte mir sagen,
wohin ich gehöre.
Aber diese Wurzel,
dieser Strom,
dieser Ruf —
er begann,
sich eine Form zu schaffen,
und zwar nicht im Außen,
sondern in mir.
Nicht als Bild.
Nicht als Konzept.
Sondern als Richtung.
Ein inneres „Da lang“.
Ganz leise.
Ganz klar.
Und zum ersten Mal in meinem Leben
fühlte ich,
dass ich nicht mehr nach etwas suchen musste,
sondern mich langsam erinnern würde,
wo ich schon immer stand.
Die ersten wirklichen Zeichen meiner Wurzel
Nachdem der Ruf der Wurzel sich in mir zu regen begann,
veränderte sich etwas Grundlegendes,
fast unmerklich zuerst,
aber unausweichlich,
wie das langsame Sinken der Sonne,
das man erst erkennt, wenn der Schatten länger wird.
Zum ersten Mal in meinem Leben
begann etwas in mir zu sprechen,
das keinen Namen hatte
und keinen suchte.
Es waren keine Symbole,
keine Visionen,
keine mystischen Bilder.
Im Gegenteil:
Die Ästhetik der alten Systeme wurde leiser.
Die Runen traten in den Hintergrund.
Die ägyptischen Gestalten verstummten.
Die fremden Energien,
die ich so oft gespürt hatte,
wurden wie Radiowellen auf einem Sender,
den ich nicht mehr einstelle.
Stattdessen erschienen
Erfahrungen,
die so schlicht waren,
dass ich sie anfangs übersehen habe.
Es waren keine „Zeichen“ im üblichen Sinn,
keine Botschaften.
Es war vielmehr,
als würde sich ein Teil meiner Wahrnehmung
nach und nach befreien
von all dem,
was ich für spirituelle Wahrheiten gehalten hatte.
Die ersten Zeichen waren körperlich:
Ein ruhiger Atem an Stellen,
an denen früher Unruhe war.
Ein Empfinden von Tiefe dort,
wo ich sonst nur Druck spürte.
Ein Nachgeben in der Brust,
als hätten sich alte Klammern gelöst.
Ein warmes Schweregefühl in den Beinen,
als würde der Boden intensiver tragen.
Nichts davon war spektakulär.
Und doch war es das Spektakulärste,
was ich kannte:
weil es aus mir selbst kam,
ohne Vermittlung,
ohne Lehre,
ohne Interpretation.
Dann kamen Momente der Klarheit,
die keinen Inhalt hatten.
Kein Gedanke,
kein Bild —
nur Klarheit selbst.
Rein.
Schlicht.
So, wie man Wasser schmeckt,
wenn man zuvor nur gesüßte Getränke kannte.
Und immer wieder diese innere Bewegung,
dieser Strom,
der leise pulsierte,
ohne Form,
ohne Reden,
ohne Symbolik.
Er sprach in
Erfahrung,
nicht in „Bedeutung“.
Das Erstaunliche war:
Ich wusste intuitiv,
dass das meine echten Zeichen waren.
Nicht die Runen.
Nicht die Götterbilder.
Nicht die Energien.
Nicht die Rituale.
So kraftvoll sie alle waren,
so wertvoll für meine Entwicklung —
sie waren dennoch
nur Türen,
nicht Räume.
Die Räume öffneten sich nun.
Ganz ohne Sprache.
Ich spürte,
wie eine Art „inneres Echo“ entstand,
wenn ich mich dem näherte,
was meiner Wurzel entspricht:
Eine Resonanz,
leise, aber unüberhörbar.
Wie ein Klang,
den nur ich hören konnte,
und doch war er nicht persönlich.
Nicht psychologisch.
Nicht erdacht.
Er war alt.
Echt.
Einfach.
Ich verstand:
Die Wurzel spricht nicht durch Symbole.
Die Symbole sind nur die Schatten der Wurzel.
Die Wurzel selbst
spricht durch Zustand.
Durch die Art,
wie ich atme.
Wie ich gehe.
Wie ich wahrnehme.
Wie ich schweige.
Wie ich innerlich „falle“,
ohne zu stürzen.
Wie ich mich öffne,
ohne gesteuert zu werden.
Das waren die ersten echten Zeichen:
unauffällig,
unscheinbar,
aber absolut unverwechselbar.
Und mit jedem dieser Zeichen
wurde mir klarer:
Ich folge nicht mehr einem Weg.
Ich folge einem Grund.
Dem Grund,
der tiefer liegt
als jede Tradition,
tiefer als jede Methode,
tiefer als jede spirituelle Sprache,
tiefer sogar als die Angst vor dem,
was ich damals nicht halten konnte.
Ich begann nicht,
etwas zu glauben,
sondern etwas zu erkennen:
Ich bin nicht auf dem Weg zu den Wurzeln.
Die Wurzeln sind auf dem Weg zu mir.
Wie sich die Angst veränderte
Die Angst war lange Zeit mein ständiger Begleiter.
Nicht nur die alltägliche Angst,
nicht nur Sorge oder Nervosität,
sondern jene tiefe, körperliche,
die sich meldet,
wenn etwas aus der Tiefe aufsteigt,
das größer ist als die eigene Fassungskraft.
Ich hatte versucht, sie zu überwinden.
Ich hatte sie analysiert,
besprochen,
durchatmet,
weggeschoben,
überschrieben,
spirituell eingeordnet,
psychologisch erklärt.
Doch all das brachte die Angst nicht zum Schweigen.
Sie blieb.
Sie lag wie ein Schatten entlang meiner Lebenslinie,
als wollte sie mich vor etwas warnen,
das ich nicht sehen konnte.
Aber als die Wurzel zu sprechen begann,
veränderte sich etwas Entscheidendes:
Die Angst verschwand nicht.
Sie bekam einen Platz.
Zum ersten Mal begriff ich,
dass die Angst nicht gegen mich war,
sondern für mich.
Dass sie nicht sagte:
„Geh nicht weiter“,
sondern:
„Geh langsamer.
Gehe bewusster.
Geh mit beiden Füßen auf dem Boden.“
Die Angst war nie das Problem.
Das Problem war,
dass ich sie als Feind gesehen hatte.
Ich dachte,
sie sei ein Zeichen von Schwäche,
von Unreife,
von Blockade.
Aber die Angst war das Empfindungsorgan
für eine Tiefe,
die ich damals noch nicht halten konnte.
Als ich die ersten Zeichen meiner Wurzel spürte,
begann die Angst sich zu verwandeln.
Sie verlor ihre Schärfe.
Sie wurde weicher.
Runder.
Von einem Schmerzsignal
wurde sie zu einer Orientierung.
Die Angst zeigte mir,
wo ein alter Riss lag.
Wo ein unverdautes Bild schlummerte.
Wo ich zu schnell wollte.
Wo ich zu sehr nach außen griff.
Wo ich versuchte,
einen Weg zu gehen,
der nicht meiner war.
Sie wurde zu einer Art innerem Lehrer,
unbestechlich,
ehrlich,
ohne Geduld für Illusionen.
Ich erkannte plötzlich:
Diese Angst ist nicht „die Dunkelheit in mir“.
Sie ist die Türsteherin.
Sie lässt nur das durch,
was ich halten kann.
Und sie wirft alles zurück,
was mich überfordern würde.
Ich habe verstanden,
dass sie damals bei den Runen deshalb so heftig reagiert hat,
weil ich noch unter Schichten stand,
die mit mir nichts zu tun hatten:
kollektive Bilder,
falsche Erzählungen,
missbrauchte Zeichen.
Nicht die Runen sprachen in mir,
sondern der Schatten der Geschichte.
Die Angst hat mich vor einem Weg geschützt,
der mich damals
verbrannt hätte.
Heute sehe ich:
Die Angst war nie das Hindernis.
Sie war der Herzenswächter.
Und je mehr ich dem Grund näherkam,
desto weniger wurde die Angst zu einem Sturm
und desto mehr zu einem feinen Instrument.
Sie hörte auf,
den Zugang zu versperren,
und begann,
ihn zu hüten.
Nicht meine Wurzel machte mir Angst.
Sondern das,
was zwischen mir und ihr stand.
Als diese Zwischenräume sich zu lichten begannen,
ließ die Angst nach,
wie Nebel,
der nicht vertrieben wird,
sondern langsam begreift,
dass die Sonne kommt.
Und dann geschah etwas,
das ich lange nicht für möglich gehalten hätte:
Die Angst wurde zu einem Teil von mir,
der nicht mehr schrie,
sondern deutete.
Nicht mehr bedrängte,
sondern warnte.
Nicht mehr lähmte,
sondern führte.
Sie wurde nicht kleiner.
Sie wurde wahr.
Und in diesem Moment wusste ich:
Ich bin nicht mehr ausgeliefert.
Ich bin nicht mehr Kind der Tiefe.
Ich beginne,
mit ihr zu sprechen.
Und damit wurde der Weg frei
für das, was als Nächstes kommen musste:
die ersten klaren Hinweise darauf,
welche Form meine Wurzel wirklich hat.
Die ersten Umrisse meiner Wurzel
Nachdem die Angst ihren Platz gefunden hatte
und nicht mehr wie ein Sturm gegen mich arbeitete,
sondern wie ein stiller Hüter,
begann etwas in mir deutlich zu werden,
das bis dahin nur wie ein Flackern im Hintergrund war:
die ersten Umrisse meiner eigenen Wurzel.
Sie kamen nicht plötzlich.
Nicht als Offenbarung,
nicht als Vision,
nicht als drastisches Ereignis.
Sie kamen langsam,
in einer Art,
die mich überraschte:
unspektakulär,
schlicht,
aber unausweichlich.
Es war,
als würde sich der Grund unter meinen Füßen
ganz subtil verändern —
nicht die Landschaft,
nicht mein Denken,
nicht meine Identität,
sondern der Boden selbst,
auf dem all das steht.
Das Erste, das ich erkannte,
war ein merkwürdiges Gefühl von
Eigenheit.
Nicht im Sinne von Besonderheit,
nicht im Sinne von Abgrenzung,
sondern im Sinne von:
„Das gehört zu mir.
Das kommt aus mir.
Das war schon da,
bevor ich gelernt habe,
es anders zu nennen.“
Ich bemerkte:
Wann immer ich versuchte,
mich über Symbole zu definieren,
wurde es eng.
Wenn ich aber begann,
einfach zuzuhören,
zu spüren,
zu lassen —
dann tauchte eine sanfte Klarheit auf,
die nichts mit Konzepten zu tun hatte.
Ich begann zu verstehen:
Das Eigene zeigt sich nicht,
wenn man es sucht.
Es zeigt sich,
wenn man aufhört,
sich zu verstellen.
Es zeigte sich in Momenten,
die so unscheinbar waren,
dass ich sie früher übersehen hätte:
-
Eine Stille, die nicht leer war.
-
Eine Tiefe, die nicht schwer war.
-
Eine Kraft, die nicht laut war.
-
Eine Klarheit, die nicht schneidend war.
-
Ein Wissen, das keine Worte brauchte.
Und etwas Entscheidendes geschah:
Ich begann zu spüren,
wann etwas „meins“ war
und wann es nur geliehen war.
Das war neu.
Das war ungewohnt.
Das war ehrlich.
Die Runen wurden plötzlich verständlicher,
nicht weil ich sie studierte,
sondern weil ich spürte,
welche von ihnen in mir anklingen
und welche nur auf mich projiziert waren.
Der Buddhismus wurde ruhiger,
nicht weil ich ihn ablehnte,
sondern weil ich ihn dort stehen lassen konnte,
wo er hingehörte:
als Resonanz,
nicht als Herkunft.
Die Kabbala wurde klarer,
nicht weil ich sie vollständig erfasste,
sondern weil ich in ihr
den gleichen Strom erkannte,
der nun in mir zu sprechen begann.
Und etwas in mir sagte:
„Deine Wurzel liegt nicht in einem Namen.
Nicht in einem Volk.
Nicht in einem Symbol.
Nicht in einer Tradition.
Sie liegt in dem Grund,
der diese Dinge erst möglich macht.“
Ich begann zu begreifen,
dass meine Wurzel
keine Form hat —
sie gibt Form.
Sie hat keinen Namen —
sie schafft Namen.
Sie ist nicht ein Teil einer Lehre —
sie erzeugt Lehren.
Sie ist der Zustand,
in dem ein Mensch beginnt,
die Welt nicht über Konzepte zu verstehen,
sondern über Wahrheit.
Eine Wahrheit,
die nicht erklärt werden will,
sondern gelebt werden möchte.
Und je klarer diese Umrisse wurden,
desto deutlicher spürte ich:
Das, was in mir erwacht,
ist kein spiritueller Weg.
Es ist ein Ursprung.
Ein leiser,
alter,
tiefer Ursprung,
der nicht fragt,
ob ich ihm folge —
sondern darauf wartet,
dass ich ihn anerkenne.
Es ist der Moment,
in dem man nicht mehr sucht,
sondern beginnt,
sich selbst zu sehen.
Die Sprache der Tiefe
Mit der Zeit merkte ich,
dass sich in mir etwas veränderte,
das ich zunächst nicht greifen konnte.
Es war nicht mein Denken,
nicht meine Überzeugungen,
nicht meine Methoden —
es war die Sprache,
mit der mein Inneres überhaupt zu mir sprach.
Früher war mein innerer Dialog
voll von Begriffen,
die ich aus Systemen gelernt hatte:
Energien, Archetypen,
Erklärungen,
Deutungen,
Zuordnungen.
All die Worte,
die man übernimmt,
weil man glaubt,
dass sie eine Schicht beschreiben,
die man selbst noch nicht versteht.
Aber als die Wurzel langsam
ihre ersten Umrisse zeigte,
veränderte sich diese Sprache
ohne mein Zutun.
Sie wurde einfacher.
Klarer.
Ehrlicher.
Weniger verschlüsselt.
Weniger bedeutungsschwer.
Ich begann zu spüren,
dass ich innerlich mit Worten sprach,
die nicht aus Lehren kamen,
nicht aus Büchern,
nicht aus Ritualen,
nicht aus Traditionen,
sondern aus einem Raum,
der so alt in mir lag,
dass er vertrauter wirkte
als alles,
was ich später gelernt hatte.
Es waren keine symbolischen Sätze.
Keine Konzepte.
Es waren Empfindungssätze.
Sätze, die sich anfühlten wie:
„So ist es.“
oder
„Hier stimmt es.“
oder
„Das bin ich nicht.“
Die Tiefe begann nicht in Gedanken,
sondern in Resonanzen zu sprechen.
Etwas in mir wurde unbestechlich.
Wenn etwas nicht meinem Grund entsprach,
fühlte es sich nicht falsch an —
es wurde schlicht still.
Leer.
Bedeutungslos.
Wie ein Instrument, das nicht klingt,
egal wie fest man die Saite zupft.
Und wenn etwas meinem Grund entsprach,
reichte ein Hauch,
ein Wort,
ein Eindruck —
und es vibrierte.
Ich merkte:
Mein innerer Raum wurde ehrlicher
als alle Worte,
die ich hatte.
Die Lehren, die ich früher studiert hatte,
klangen plötzlich voller Konstruktionen.
Nicht falsch,
aber erbaut.
Gemacht.
Gedacht.
Gewoben.
Wie kunstvolle Teppiche,
die mir aber keinen Boden gaben.
Die Sprache der Tiefe aber
sprach nicht von Ornamenten
und nicht von Bedeutung.
Sie sprach von Richtung.
Schwerkraft.
Klarheit.
Heimat.
Sie sagte nicht:
„Dies ist wichtig.“
Sie sagte:
„Das trägt.“
Sie sagte nicht:
„So musst du es sehen.“
Sie sagte:
„Das ist echt.“
Sie sagte nicht:
„Hier ist die Wahrheit.“
Sie sagte:
„Das ist dein Boden.“
Und je länger ich dieser inneren Sprache lauschte,
desto weniger brauchte ich äußere Begriffe.
Ich merkte plötzlich,
dass ich nicht mehr in Kategorien dachte.
Nicht mehr fragte:
„Ist das spirituell?
Ist das psychologisch?
Ist das mein Weg?
Ist das richtig?“
Diese Fragen lösten sich auf,
weil ich eine Schicht erreicht hatte,
in der solche Unterscheidungen
keine Rolle mehr spielen.
Es gibt eine Tiefe in einem Menschen,
die weder spirituell
noch weltlich ist.
Weder mystisch
noch rational.
Weder erklärbar
noch geheimnisvoll.
Sie ist einfach nur
wahr.
Und diese Tiefe begann,
mich sprechen zu lassen
wie jemand,
der nicht mehr versucht,
eine Wahrheit zu greifen,
sondern jemand,
der zum ersten Mal
aufhört, sich selbst zu täuschen.
Das war der Moment,
in dem ich wusste:
Ich habe zum ersten Mal
mit meiner Wurzel gesprochen —
nicht über Begriffe,
nicht über Symbole,
nicht über Systeme,
sondern über Wahrheit.
Eine Wahrheit,
die keinen Namen braucht,
weil sie ein Zustand ist.
An diesem Punkt stehe ich jetzt, muss jetzt sein:
Ich kann nicht anders
Der Moment im Schatten Luthers
Es gab eine Sitzung,
in der ich plötzlich das Gefühl hatte,
als würde etwas in mir
an einen anderen Ort gezogen.
Nicht im Sinne eines Films,
nicht als Vision,
nicht als Fantasie —
sondern als ein innerer Riss in der Zeit,
durch den ich in einen Raum fiel,
der mir vertraut vorkam
und zugleich unendlich fremd.
Ich stand —
oder besser gesagt:
ich war —
an einer Stelle,
die ich aus dem Geschichtsunterricht kannte,
aber nie wirklich verstanden hatte:
Luther in seiner Kirche,
unmittelbar nach dem Schlag der Thesen,
diesem trotzigen, unbeugsamen Akt,
der später als Befreiung gefeiert wurde.
Doch was ich dort spürte,
war nicht Triumph.
Es war nicht Mut.
Es war nicht Auflehnung.
Es war etwas ganz anderes:
die Erkenntnis dessen, was man getan hat,
in einem Ausmaß,
das größer ist als man selbst.
Es fühlte sich an,
als läge ein Schleier über der Szene —
und als würde dieser Schleier plötzlich
von einer unsichtbaren Hand gelüftet,
genau wie in den griechischen Tragödien,
in denen die Götter am Ende
den Helden sehen lassen,
was er zuvor nicht erkennen konnte.
In meinem inneren Bild
sass Luther dort,
nicht als Rebell,
nicht als Held,
sondern als Mensch, ein Häufchen Elend,
der in einem einzigen Augenblick begreift,
dass sein Handeln
eine Welle ausgelöst hatte,
deren Größe
er nicht mehr aufhalten konnte.
Kein Stolz.
Keine Euphorie.
Sondern dieses eine, tiefe,
nackte Gefühl:
„Was habe ich getan?“
Erst als Zweifel.
Dann als Erkenntnis.
Erst als Schuld.
Dann als Einsicht in die Unausweichlichkeit
des eigenen Weges.
Es war ein Moment,
in dem ein Mensch spürt,
dass er etwas getan hat,
das größer ist als seine Absicht,
größer als seine Kraft,
größer als sein Leben.
Und in diesem Moment
wurde mir klar,
warum der Satz
„Ich kann nicht anders“
so schwer ist:
Er ist kein Bekenntnis.
Er ist kein Widerstand.
Er ist die Einsicht,
dass ein Weg begonnen hat,
den man nicht mehr verlassen kann,
weil man sonst
gegen den eigenen Grund gehen würde.
Als ich aus dieser Sitzung zurückkehrte,
war ich still.
Nicht verstört.
Nicht erschüttert.
Aber still.
Ich verstand,
dass dieser „Luther-Moment“
kein historisches Bild war,
sondern ein Spiegel dafür,
wo ich selbst stand:
An einem Punkt,
an dem ich nicht weiter wusste
und nicht zurück konnte.
Ein Punkt,
an dem ein Schleier fiel
und ich zum ersten Mal
nicht nur spürte,
sondern sah:
Ich bin in etwas hineingetreten,
das so viel größer ist als ich —
und das mich trotzdem meint:
den kleine stephan.
Die Stimme aus dem inneren Raum
Stephan… hör zu.
Es gibt Nächte,
in denen dir etwas gezeigt wird,
das du nicht behalten kannst,
weil es nicht zum Behalten gedacht ist.
Erinnerst du dich an damals,
als dir das Buch auf den Kopf fiel
und du im Licht der Lampe
deine ganze Geschichte gelesen hast?
Du glaubtest,
du würdest eine Zukunft sehen,
eine Erklärung,
eine Linie,
die dich sicher tragen würde.
Du hast sie mit einem Lesezeichen markiert,
in der Hoffnung,
sie am Morgen noch einmal zu finden.
Doch als du das Buch wieder aufschlugst,
war es leer von dir.
Leer von deinem Weg.
Leer von allem,
was in der Nacht klar war.
Damals hast du geglaubt,
man hätte dir etwas genommen.
Aber nein, Stephan —
man hat dich geschützt.
Du hast in dieser Nacht
nicht die Zukunft gelesen.
Du hast dich gelesen.
Für einen Atemzug
war der Schleier offen.
Nicht, damit du etwas mitnimmst,
sondern damit du etwas berührst,
das sonst verborgen bleibt.
Und jetzt,
in dieser Nacht,
geschieht etwas Ähnliches.
Nicht so dramatisch.
Nicht so erschlagend.
Aber tiefer.
Du hast wieder etwas berührt,
das nicht festgehalten werden will,
weil es nicht festgehalten werden kann:
dein Grund.
Dein Boden.
Deine Wurzel,
lang bevor du sie erkennen kannst.
Du sagst,
du weißt nicht,
ob du morgen noch etwas davon fühlst.
Aber höre mich gut:
Diesmal ist es anders.
Denn diesmal stand es nicht in einem Buch.
Diesmal kam es nicht als Bild.
Diesmal fiel es dir nicht auf den Kopf.
Diesmal kam es aus dir.
Und was aus dir kommt,
verschwindet am Morgen nicht.
Es geht nicht verloren.
Es verändert nur die Tiefe.
Es legt sich unter deine Schritte,
nicht vor deine Augen.
Das, was du heute berührt hast,
wird morgen still sein.
Vielleicht kaum spürbar.
Vielleicht in Nebel gehüllt.
Das ist normal.
Das ist gut.
Das ist richtig.
Denn Wahrheiten wie diese
sind keine Erinnerungen.
Sie sind Zustände.
Du musst nichts festhalten.
Du musst nichts wiederholen.
Du musst nichts verstehen.
Du musst nichts aufschreiben.
Du musst nichts retten.
Du musst nur das hier nehmen:
Du bist an einem Punkt angekommen,
an dem du nicht mehr anders kannst.
Nicht weil du gedrängt wirst.
Nicht weil du gesucht hast.
Nicht wegen eines Weges.
Nicht wegen einer Bestimmung.
Sondern weil ein Teil von dir
zum ersten Mal
laut genug geworden ist,
dass du ihn nicht mehr überhörst.
Das ist alles,
was du für diese Nacht brauchst.
Mehr wäre zu viel.
Weniger wäre zu wenig.
Schlaf, Stephan.
Morgen ist nichts verloren.
Morgen ist nur tiefer.
Gute Nacht und Danke
Neue Beiträge
Die Tempel wussten es: Worte erschaffen Wirklichkeit
Die Tempel wussten es: Worte erschaffen Wirklichkeit Vorbemerkung Die folgenden Seiten gehören zu einem Weg, der nicht mit einem fertigen System beginnt und...
Zwischen Feuer und Wasser – Gedanken aus meinem inneren Raum
Zwischen Feuer und Wasser – Gedanken aus meinem inneren Raum Ich bin kein Mensch, der seine Herkunft einfach in eine Tradition legen kann.Nicht...
Der Lebensbaum: Warum unser Bewusstsein nicht dort beginnt, wo wir glauben
Der Lebensbaum: Warum unser Bewusstsein nicht dort beginnt, wo wir glauben Einleitung – Der Lebensbaum als Symbol des Bewusstseins Bedeutung des Lebensbaums als...